
Einige unserer meistgespielten Alben des Jahres
Welche Alben und Songs das ByteFM Team in diesem Jahr herausragend fand, haben wir Euch bereits verraten. Die Bestenlisten unserer Moderator*innen waren natürlich höchst subjektiv – und darum lassen wir jetzt nochmal die Zahlen sprechen und ziehen Bilanz: Was wurde tatsächlich am häufigsten gespielt? Hierzu haben wir Playlisten analysiert, Song-Einsätze gezählt, Punkt vor Strichrechnung beachtet und haben nun unterm Strich: die 40 meistgespielten Alben der vergangenen zwölf Monate bei ByteFM.
Präsentiert wurde die Liste von Friederike Herr am 29. Dezember 2020 in einem Freispiel. Mitglieder im Förderverein „Freunde von ByteFM“ können die Sendung auch in unserem ByteFM Archiv nachhören.
Eine letzte Bestenliste des Jahres gibt es noch als krönenden Abschluss am Silvesternachmittag: Eure Lieblinge. Die Ergebnisse des ByteFM Polls präsentieren wir Donnerstag, den 31. Dezember 2020 in den Jahrescharts der Hörer*innen. Mit den Künstlerinnen und Künstlern, die Euch am meisten bedeutet haben, dem beliebtestem Album, den überraschendsten Newcomern, drei Stunden lang in unserem Programm. Von 14 bis 17 Uhr in den, moderiert von Ruben Jonas Schnell.
Unsere meistgespielten Alben des Jahres:

40. Sorry – „925“
Zwei Menschen treffen in der Schule aufeinander. Sie werden Freund*innen. Beide machen Musik. Sie laden ihre jeweiligen Songs auf Soundcloud hoch. Es entbrennt ein kleiner Wettstreit darüber, wer die besseren Songs schreiben kann. Irgendwann passiert das Unausweichliche: Asha Lorenz und Loui O’Brien gründen gemeinsam eine Band. Sie heißt Sorry und veröffentlichte dieses Jahr ihr Debütalbum. Auf „925“ klingen die beiden Brit*innen aber nicht wie Gegner*innen, sondern wie lebenslange Gefährt*innen, die mit Leichtigkeit die Sätze des bzw. der jeweils anderen beenden können. Ihr Indie-Rock ist ein wunderbares Gemeinschaftswerk, ein Album voller Duette und rotziger Refrains – und auf „Did It Again“ gab es das schönste „Eugh“ des Jahres zu hören.

39. Idris Ackamoor & The Pyramids – „Shaman!“
Bei dem Energielevel, das Idris Ackamoor & The Pyramids auf „Shaman!“ an den Tag legen, fällt nicht auf, dass der Kopf dieser Gruppe schon fast 70 Jahre alt ist. Der von Free-Jazz-Legende Cecil Taylor ausgebildete Saxofonist startete seine Funk und Space-Jazz fusionierende Karriere in den 70er-Jahren. Auf „Shaman!“ ist der US-Amerikaner aber sowas von gar nicht altersmilde – stattdessen schweift er mit seiner Band lustvoll und unglaublich tight in höchste Stratosphären ab.

38. Keleketla! – „Keleketla!“
Übersetzt man Keleketla aus dem Setswanischen, ergibt das „Antwort“. Matt Black und Jonathan More aka Coldcut legen die Betonung ihres Projektnamens auf das Ausrufezeichen. Gemeinsam mit einem großen, von Südafrika über Nigeria, New York und Papua-Neuguinea bis nach London verstreuten Musiker*innen-Pool bieten die beiden Briten eine Antwort, die in ihrer Genre- und Ländergrenzen einreißenden Dynamik alle Fragen obsolet macht. Ein fesselnder Malstrom aus Afrobeat, Qnom, Grime, Drum & Bass, Highlife und Jazz. Mit Gastauftritten von Shabaka Hutchings, Antibalas und Tony Allen!

37. Sevdaliza – „Shabrang“
Als Sevda Alizadeh alias Sevdaliza vor drei Jahren das erste Maul auf sich aufmerksam machte, warfen viele den schwammigen Sammelbegriff „Trip-Hop“ in ihre Richtung. Und lagen falsch. Die Musik der niederländisch-iranischen Künstlerin ist zu groß für Schubladen – wie sie auf ihrer zweiten LP endgültig bewies. Auf „Shabrang“ gibt es tieftraurige Balladen, gesungen in Farsi. Auch wenn man die Wörter nicht versteht, trifft jede Silbe wie ein Dolch das Herz. Es gibt ein apokalyptisches Zwitterwesen, halb House-Track, halb Nick-Cave-Moritat, mit dem Namen „The Darkest Hour“. Es gibt mit geisterhaften Streichern und verzerrten Samples verzierten Avant-Pop. Und noch so viel mehr.

36. LA Priest – „Gene“
Sam Dust ist stetig in Bewegung. Auch wenn man länger mal nichts von ihm hört. Bis 2010 war der Brite Teil der zappeligen Dance-Punk-Truppe Late Of The Pier. 2016 gründete er gemeinsam mit Connan Mockasin das Yacht-Rock-Duo Soft Hair. 2018 schrieb er Songs für Franz Ferdinands Comeback-LP „Always Ascending“. Und seit 2015 arbeitet er solo als LA Priest. In der Rolle dieses kalifornischen Gottesmannes zelebriert er smoothen Lo-Fi-Funk, der auch dieses Jahr auf dem Album „Gene“ überaus anschmiegsam und tanzbar daher kam. Stillstehen ist hier unmöglich.

35. Aksak Maboul – „Figures“
Ein willkommenes Lebenszeichen einer weitgehend vergessenen Band: Das erste Album der belgischen Avantgarde-Pop-Formation Aksak Maboul erschien 1977. Ihre dritte Studio-LP veröffentlichten sie 2020. Trotz mehrerer Jahrzehnte Pause schließt „Figures“ nahtlos an die vorigen Alben an: Mal fühlt man sich an Steve Reich erinnert, der unvermittelt von einem Free-Jazz-Ensemble unterbrochen wird. Dann an die englische Avant-Pop-Band Flying Lizards, auch Stereolab sind nicht allzu weit weg. „Figures” ist ein Doppelalbum, in über 30 Jahren sammeln sich schließlich einige Ideen an. Aufgrund der stilistischen Vielfalt wird es trotz der Länge nie langweilig.

34. Mint Mind – „Thoughtsicles“
Wenn Rick McPhail nicht in einer gewissen Hamburger Schlaumeier-Rock-Institution Gitarre spielt, lässt der in Maine geborene Musiker die Trainingsjacke zu Hause – und schrammelt in der Band Mint Mind um sein Leben. Mit diesem Projekt spielt er Skuzz-Rock und Lo-Fi-Punk, charmant polternd, immer mit der nächsten catchy Hookline im Blick. Auf ihrem zweiten Album „Thoughtsicles“ singen Mint Mind über Joy-Division-T-Shirts, eine Welt ohne rassistische Politiker*innen – und liefern nebenbei ein wunderbar kantiges Billy-Bragg-Cover. Großes Highlight: der zehnminütige, sich lustvoll in Stoner-Riffs und Gitarren-Kaskaden verlierende Titeltrack.
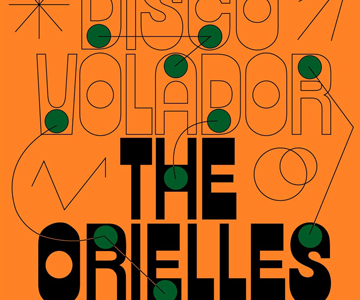
33. The Orielles – „Disco Volador“
„Disco Volador“ bedeutet frei übersetzt „fliegende Scheibe“. Das kann ein UFO sein. Oder eine Schallplatte. Oder ein Frisbee. Auf jeden Fall etwas, das sich bewegt und dreht. Ein passender Titel für das zweite Album von The Orielles. Die Band um die britischen Schwestern Sidonie B. und Esmé Dee tanzt auf „Disco Volador“ in lustigen Schlaufen. Die Bandmitglieder sind alle Kinder dieses Jahrtausends, dementsprechend klingt ihre Musik wie aus allerlei obskuren Playlisten zusammengewürfelt: Psychedelische Bossa-Nova-Disco („Come Down On Jupiter“), funky Post-Punk („Bobbi’s Second World“) und Samba aus dem Weltall („Space Samba …“). Insgesamt: eine der buntesten Indie-Pop-Platten dieses Jahres.

32. Alice Boman – „Dream On“
Eigentlich wollte Alice Boman ihre Musik, die sie mit einem Diktiergerät am Klavier sitzend aufnahm, nie veröffentlichen. 2013 fasste sich die Schwedin dennoch ein Herz und stellte ihre Demo-EP „Skisser“ ins Internet. Eine sehr gute Entscheidung. 2020, sieben Jahre später, erschien ihr Debüt „Dream On“, eine Sammlung von verträumten Folk-Pop-Songs. Ihre Musik scheint wie auf Zehenspitzen aufgenommen zu sein. Bomans Gesangsharmonien sind dicht, das Schlagzeug minimal und warm, die Klaviertupfer nah am Ohr und fern zugleich. Wenn sie „Set My Heart On Fire“ verlangt, ist das keine inbrünstige Aufforderung, sondern ein sanftes An-die-Hand-nehmen. In diesen Songs kann man sich lange verlieren.

31. Jehnny Beth – „To Love Is To Live“
Wenn Savages-Anführerin Jehnny Beth über Liebe singt, beschreibt sie eine Urgewalt. Das Debütalbum der Britin trägt den Titel „To Love Is To Live“ – und demonstriert mit Nachdruck, dass Beth auch ohne ihre Bandmitstreiterinnen Urgewalten kanalisieren kann. Den Post-Punk von Savages tauscht sie gegen pulsierendes Darkwave-Chaos. Hypnotische Elektronik und nervös flirrende Balladen. Elf Songs über das Leben, den Tod, das Menschsein und – alles zusammenhaltend – die Liebe.
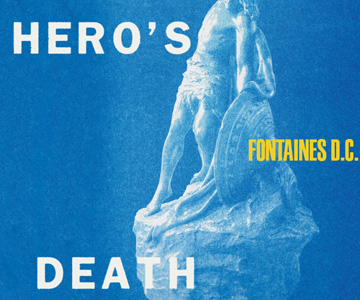
30. Fontaines D.C. – „A Hero’s Death“
Ziemlich exakt ein Jahr nach ihrem Türen öffnenden und Gehörgänge infiltrierendem Debüt „Dogrel“ veröffentlichte die irische Band Fontaines D.C. direkt ihr zweites Werk. Und das steht dem Vorgänger in Nichts nach. Die Feder von Sänger und Texter Grian Chatten ist immer noch spitz, seine Augen scharf. Auch die fast schon unverschämt eingängigen Indie-Rock-Melodien sind wieder da, wenn auch etwas atmosphärischer, graziler. Im Vergleich zum ersten Album gibt es mehr Raum zum Atmen – und das steht dieser Band sehr gut.

29. Deradoorian – „Find The Sun“
Hätten Can ein Album mit Nico aufgenommen, wäre wahrscheinlich eines der besten deutschen Alben entstanden. „Find The Sun“, das zweite Album des ehemaligen Dirty-Projectors-Mitglieds Angel Deradoorian, vermittelt einen Eindruck davon, wie diese Kollaboration hätte klingen können. Die Songs der Kalifornierin vereinen treibenden Psych-Rock und in nervösen Schleifen oszillierenden Krautrock mit getragenem, anmutigem Gesang. Deradoorian demonstriert auf diesem Album die Kunst, einen Acid-Trip mit erhobenem Haupt durchzustehen.

28. Erregung Öffentlicher Erregung – „EÖE“
Für ihr Debütalbum haben sich Erregung Öffentlicher Erregung viel vorgenommen. „EÖE“ ist im Vergleich zu den ersten EPs des zwischen Hamburg und Berlin pendelnden Quintetts ein massives Werk: 20 Songs, 56 Minuten. Vorbei ist die Zeit des fokussierten NDW- und Post-Punk-Kurztrips, stattdessen bieten Erregung Öffentlicher Erregung Exzess. Schwurbelige Skits und Instrumentals laden zum Abdriften ein. Ein dystopischer Disco-Downer darf sich über fünf Minuten erstrecken. Jeder Song atmet. Sängerin Anja Kasten kann ihre vergiftete Lakonie auf der Länge dieses Albums voll ausbreiten.

27. Run The Jewels – „RTJ4“
Killer Mike und El-P hätten auf die thematische Aktualität ihres neuesten Werks gerne verzichtet. Die beiden US-Amerikaner schrieben die vierte LP ihres Duos Run The Jewels bereits Anfang des Jahres, vor der Ermordung George Floyds und den daraus resultierenden Protesten. Nun schufen sie nahezu prophetisch einen „Protestsoundtrack“. Doch „RTJ4“ ist noch viel mehr. Wer nur Antirassismus für Trendbefriedigung in 280 Zeichen sucht, bekommt schon nach solchen Raps wie „And you so numb you watch the cops choke out a man like me / Until my voice goes from a shriek to whisper, ‚I can’t breathe’“ entzückte Schnappatmung. Doch Run The Jewels‘ Wutschnauben holt tiefer Luft, um sich eben nicht nur am offensichtlichen Missstand abzuarbeiten, sondern an der Perversion einer Medialisierung von Rassismus. „RTJ4“ ist ein Rave auf Asphalt mit erhobener Faust. Kämpferisch, zynisch, wehmütig.

26. Shabazz Palaces – „The Don Of Diamond Dreams“
Shabazz Palaces werden von Album zu Album besser. „The Don Of Diamond Dreams“ ist ein Album, bei dem alles mit schlafwandlerischer Sicherheit zusammenfindet. Seit etwa zehn Jahren macht das Duo aus Seattle Musik, doch hier kommen die disparaten Einflüsse von Ishmael Butler und Tendai „Baba“ Maraire erstmalig zu einem durchweg hervorragenden, kohärenten Album zusammen. „The Don Of Diamond Dreams“ bezieht Dub, Funk, Jazz und R&B in seinen HipHop mit ein, was für sich genommen ein alter Hut ist. Einmalig ist, auf welche Weise das geschieht. Die Jazzelemente sind keine reinen Soundverweise. Sie sind auch nicht „loungy“. Sie sind eher verstörend als gemütlich. „The Don Of Diamond Dreams“ ist ein ungewöhnliches und überraschendes Werk, das die Messlatte sehr hoch legt.
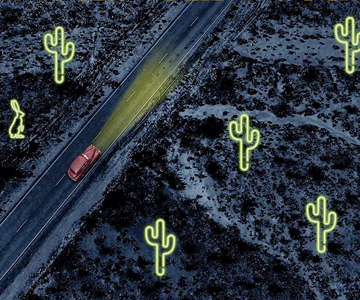
25. Bill Callahan – „Gold Record“
Bill Callahan weiß um die Kraft einer guten Leerstelle. Die Diskografie des US-Amerikaners ist voll von ihnen: Vom schranzigen Lo-Fi-Freak-Folk seiner Smog-Anfänge bis zu den altersmilden und – weisen Americana-Platten, die er mittlerweile unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlicht. Erst im vergangenen Jahr erschien mit „Shepherd In A Sheepskin Vest“ seine bisher umfangreichste Platte, ein 20 Songs und fast 64 Minuten umspannendes Doppelalbum. Sein neues, nur halb so langes Album „Gold Record“ ist von etwas konzentrierterer Natur. Raum lässt Callahan trotzdem: Die analog aufgenommenen Songs sind so minimalistisch arrangiert, dass das Rauschen der Bandmaschine stets klar zu hören ist. Callahan weiß nicht nur, wie wichtig Leerstellen sind – er weiß vor allem, wie man sie perfekt füllen kann.

24. Becca Mancari – „The Greatest Part“
Es gibt ja manchmal solche Glücksgriffe: Man kauft zum Beispiel ein Kleidungsstück, das sich so perfekt in den eigenen Stil einfügt. Es ist so vertraut, als wäre es schon immer da gewesen. Aber im Gegensatz zu Kleidungsstücken, die nicht auffallen, weil sie langweilig sind, werden sie umgehend geliebte Konstanten im Alltag. Die Musik von Becca Mancari ist da ähnlich. Nur zum Hören und nicht zum Anziehen. Der New Yorkerin ist es mit ihrem zweiten Album „The Greatest Part“ erneut gelungen, total straighte, simple Popsongs aufzunehmen, die nicht nach irgendwelchen Indieklischees klingen, sondern ziemlich frisch. Dieses Kunststück glückt ihr dank cleverer Arrangements, zackiger Rhythmen und einem beneidenswerten Gespür für Melodien.

23. Oneohtrix Point Never – „Magic Oneohtrix Point Never“
Daniel Lopatin konzipierte sein neuestes Album wie einen nicht endenden Fluss aus Radiowellen – inklusive harten Genre-Wechseln, die wie hektische Kanalwechsel anmuten. Wobei diese „Kanäle“ – wie man es bei seinem Projekt Oneohtrix Point vermuten würde – nicht viel mit kommerziellem Radio zu tun haben. Eine blubbernde Ambient-Meditation mutiert binnen Sekunden zu treibender Electronica. Ein verträumtes Pop-Stück reißt kurz vorm Höhepunkt ab und verwandelt sich in abstrakten Noise. Auch „Moderationen“ gibt es in seinem Radio – doch die Stimmen sind verzerrt und die Wörter rätselhaft. Inmitten dieser konzeptionellen Kopfmusik versteckt Lopatin doch durchaus einige Momente, die genau das tun – zu ihrem Publikum sprechen. Manchmal wechselt sein Radio nämlich zu wunderbarer Pop-Musik – zur schönsten seiner Karriere.

22. Jerry Paper – „Abracadabra“
Hört man nicht genau hin, dann ist „Abracadabra“ ein sehr smoothes Album. Lucas Nathan aka Jerry Paper hat für seine neue LP erstmals eine vierköpfige Band um sich versammelt, die eine klebrig-süße Mischung aus Funk und R&B spielt. Manchmal wabert, wie im Opener „Quicksand“, eine genüsslich verzerrte Gitarre vorbei, mal zerschneidet ein seltsamer Synthesizer die vernebelte Luft. Doch die Smoothness trügt. „It feels so big / A bundle in my throat / It feels like I’ll explode“, singt Nathan in „Spit It Out“. Sein Gesang, ein weiches Crooning irgendwo zwischen Frank Sinatra und Ariel Pink, stolpert, bringt nur zwei Silben auf einmal heraus. Die unausgesprochenen Wörter bleiben im Hals stecken, versetzen die angenehmen Smooth-Jazz-Vibes des Songs mit einer nur schwer auszuhaltenden Spannung. Jerry Paper weiß: Die nicht gesagten Worte sind manchmal mächtiger als die gesagten.

21. Nubya Garcia – „Source“
Dass der spannendste Jazz der Gegenwart in Großbritannien produziert wird, müsste mittlerweile bekannt sein. Im Zentrum dieser Szene: Nubya Garcia. Wer einen Überblick über den aufregenden UK-Jazz erhalten möchte, muss sich nur die Bands anhören, denen die 29-jährige Saxofonistin und Bandleaderin mit Wurzeln in Trinidad und Tobago sowie Guyana vorsteht: Dazu zählen das Highlife, Funk und HipHop verquirlende Septett Nérija, ihre Jazz-Fusion-Gruppe Maisha sowie ihre eigene Nubya’s Five. Wobei „vorstehen“ bei diesen basisdemokratischen Kollektiven nie ganz stimmen kann. Deswegen ist es umso spannender, wenn Garcia ein Soloalbum veröffentlicht. „Source“ ist ganz und gar ihr Album. Hier spielt sie Jazz-Funk aus der Herbie-Hancock-Schule, ätherische Balladen und virtuos groovende Dub-Freakouts. Es demonstriert abermals: Garcia ist mehr als nur eine virtuose Saxofonistin – sie ist eine außerordentlich reflektierte Künstlerin, die Jazz als Spiegel für die Gegenwart nutzt.

20. Moses Boyd – „Dark Matter“
Apropos UK-Jazz: Moses Boyd ist ein weiteres prominentes Bindeglied der Londoner Szene. Er trommelte auf einigen der wichtigsten Jazz-Platten der Szene: auf Sons Of Kemets Durchbruchsalbum „Your Queen Is A Reptile“, auf Joe Armon-Jones‘ Fusion-Extravaganza „Turn To Clear View“. Auch über den UK-Jazz-Tellerrand hinaus ist es schwer, seinen polyrhytmischen Wirbelstürmen auszuweichen: Er war Drummer für Experimental-Soul-Durchstarter*innen wie Sampha oder Kelsey Lu. All diese dispersen Fäden – eklektischer UK-Jazz, Electronica, Post-R&B, Afrobeat, HipHop – laufen auf Boyds Solodebüt zusammen. „Dark Matter“ zeigt ihn nicht nur als meisterhaften Schlagzeuger, sondern auch als kreativen Komponisten und Produzenten. Im Opener „Stranger Than Fiction“ verwebt er ein an Miles Davis erinnerndes Trompetensolo mit Trap-Hi-Hats und kräftigen Bläser-Fanfaren, die auch aus einem Grime-Track stammen könnten. „Dark Matter“ ist mehr als nur Jazz. Es ist ein Grenzen ignorierendes Gesamtkunstwerk – genauso abenteuerlich und bunt wie die Szene, die es repräsentiert.

19. Shopping – „All Or Nothing“
Junge Bands, die sich irgendwie vage an Gang Of Four oder Au Pairs orientieren, gibt es derzeit wie Kiesel an der englischen Kanalküste. Beides super Bands, und prinzipiell sehr erfreulich, wenn sich auf sie bezogen wird. Allerdings schaffen es die Wenigsten, dem von den genannten Bands bereits Gesagtem etwas Wesentliches hinzuzufügen. Shopping gelingt das jetzt schon auf dem vierten Album in Folge. Sie nehmen die Haltung und den Groove der Bands lediglich als gedankliche Grundlage, als Sprungbrett, von dem aus sie eigenständige Musik zur heutigen Zeit produzieren. Auf „All Or Nothing“ mischen die Briten noch eine Prise Italo-Disco, Jazz-Piano und New Romantic hinzu – und singen dabei über den Druck, den die kapitalistische Gesellschaft auf jeden Einzelnen ausübt, über den Abbau der Bürgerrechte und zunehmende Aggressivität der Menschen untereinander. So catchy wie auf „All Or Nothing“ waren Shopping noch nie.

18. Dexter – „Yung Boomer“
Dass ein abgeschlossenes Medizin-Staatsexamen in der Tasche nicht für die größte Street-Credibility sorgt, ist Felix Göppel aka Dexter durchaus bewusst. Beziehungsweise egal. Die Songs des in Heilbronn geborenen Rappers und Produzenten erwecken nie den Eindruck, dass hier einer irgendjemandem etwas beweisen möchte. Göppel rappt in „Luft“ darüber, keine Lust auf den Club zu haben und lieber morgens um 9 Uhr seinen Kindern Müsli zu machen. Anstatt Koka gibt‘s Kaffee, anstatt Chevrolet fährt er einen VW Caddy. Bei der Polizeikontrolle finden sie nur Heilsalbe unterm Kindersitz. „Ok Boomer“, adlibt er selbstironisch in „Kontrolle“. Doch dieser „Yung Boomer“ hat viele Facetten. Er kann sich zum Beispiel nicht nur über sich selbst lustig machen, sondern auch wunderbar austeilen.

17. Idles – „Ultra Mono“
Der Aufstieg von Idles war ein besonders schneller. Binnen drei Jahren hat sich die Band aus Bristol vom spitzfedrigen Punk-Darling zum festen Teil der Line-ups weltweiter Festival hochgearbeitet. Der nächste logische Schritt wäre das Stadion. Die Autowerbung. Gassenhauer hat die Band mehr als genug, um sich in einen gemütlich stagnierenden „Ruhestand“ zu begeben. Doch Stillstand ist ein Konzept, das sich nicht mit Idles vereinen lässt. Ihr drittes Album „Ultra Mono“ hält das Aggressions- und Intelligenzlevel, das die Vorgänger „Brutalism“ und „Joy As An Act Of Resitance“ vorgelegt haben. Idles sind immer noch kompromisslos. Giftig. Eine absolute Urgewalt.

16. Good Sad Happy Bad – „Shades“
Mica Levi transzendiert. Und das von Beruf. Es gibt in der westlichen Pop-Welt wohl nur Wenige, die so fluide sind wie das Produzent*innenwunder aus dem britischen Surrey. Wo Mica Levi draufsteht, kann so ziemlich alles drin sein: ob schrammeliger Avant-Indie, unterkühlter R&B-UK-Garage-Hybrid oder ein Oscar-nominierter Filmsoundtrack. Diese Wandlungsfähigkeit überträgt sich auch auf die Band, in der Levi seit 2008 aktiv ist. Die hieß einst Michachu & The Shapes, nun trägt sie den Namen Good Sad Happy Bad. Mit der Abenteuerlust von Post-Punk-Dekonstrukteuren wie This Heat oder Pere Ubu zerlegt die Band den Pop in seine Einzelteile und fügt ihn in seltsamen Kombinationen wieder zusammen. Eigentlich könnten Songs wie „Blessed“, „Believe It“ oder „Shades“ liebliche Indie-Pop-Songs sein. Doch die Gitarren leiern verstimmt. Der Gesang ist distanziert. Das Saxofon singt neben dem Beat. Man sollte es sich mit „Shades“ nie zu gemütlich machen.

15. Sufjan Stevens – „The Ascension“
Sufjan Stevens hat sich verändert. Vom Poeten, der in den Nullerjahren US-Lokalkolorit in herzzerreißende Americana verwandelte, ist nach eigener Aussage nicht mehr viel übrig: „Ich bin alt und der Welt überdrüssig geworden“, sagte der 45-Jährige dem Magazin The Atlantic. „Ich bin todmüde. Ich bin desillusioniert.“ Und wie klingt die Musik, die dieser Griesgram jetzt macht? So bunt, lebendig und aufmunternd wie lange nicht mehr. „The Ascension“, das achte Album von Sufjan Stevens, ist mehr Synth-Pop als Indie-Folk. Dennoch ist „The Ascension“ so gar kein Friede-Freude-Eierkuchen-Album. So leicht und bunt die Musik daherkommt, so direkt und anklagend ist ihr Sänger. „The Ascension“ ist ein Balanceakt zwischen harscher Kritik und himmlischen Harmonien. Zwischen Existenzkrise und Ermächtigung. Diesen Drahtseilakt vollführt er über 80 Minuten. In einer Hinsicht hat sich Stevens nicht verändert: Er ist immer noch der Meister der traurigen Wohlfühlmusik.

14. Khruangbin – „Mordechai“
Das texanische Trio Khruangbin setzt mit „Mordechai“ seine Reise durch Kontinente und Stile fort. Diesmal weniger wild zusammengewürfelter Kassettenfetisch als noch auf den vorigen Alben spielen sie mehr denn je ihren eigenen Groove. „So We Won’t Forget“ holt den Funk der Prä-Disco-Ära hervor, „Dearest Alfred“ mischt etwas Soul unter. Mit „Pelota“ gibt es einen Song, der das Gefühl lateinamerikanischer Bars so lebhaft transportiert, als würde man mittendrin sitzen. Egal ob Thai- und Latin-Funk, Oriental-Rock oder westlich geprägter Rhythm & Blues durch das Blätterdach geistern – ein Gefühl endloser Wärme umweht „Mordechai“.
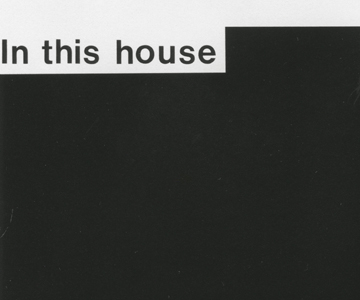
13. Lewsberg – „In This House“
Lewsberg aus Rotterdam sind wahrlich nicht die einzige Band, die sich derzeit auf Pre- oder Post-Punk bezieht. Aber man täte ihnen unrecht, sie mit den unzähligen anderen Veröffentlichungen des Genres ungehört liegen zu lassen. Kein hektisch-nervöser Beat mit verzerrten Gitarren, kein aufgesetztes Görentum. Vielmehr eine gelassene Neuinterpretation des Erbes von Velvet Underground und Television. Schlängelnde, repetitive Gitarrenlinien, gleichgültig dissonante Soli. Waiting for the man under a marquee moon. Sänger Arie van Vliet nölt sich lakonisch wie Lou Reed durchs Geschehen. Oder wie ein außergewöhnlich schlecht gelaunter Jonathan Richman. Dass „In This House“ nie langweilig wird, liegt auch daran, dass es weniger ein Album ist, als eine Sammlung von sehr unterschiedlichen Songs, die lose durch den Sound und den, sagen wir mal „Spirit“, zusammengehalten werden. Lewsberg erheben das Zerfasern gekonnt zum Konzept.

12. Ela Minus – „Acts Of Rebellion“
Vielleicht muss ja alles gar nicht so schwer sein. Das erzählt uns jedenfalls Ela Minus. „If you have to go to the bottom of a hole / To find what’s wrong / Just let it go“, singt die Kolumbianerin auf ihrer Debütsingle. Was sich ein bisschen wie ein motivierender Postkarten-Spruch liest, hat aber mehr Dimensionen. Das verrät auch der Titel dieser Single: „They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong“. Minus, die mit bürgerlichem Namen Gabriela Jimeno heißt, muss das „They“ nicht definieren, um klarzustellen, wen oder was sie meint. Ihre Musik klingt erst einmal distanziert, gefüllt mit stoisch pulsierenden Synthesizern und unterkühlt intoniertem Gesang. Nach 80er-Jahre-Wave und dem zeitgenössischen Synth-Pop, der von ihm beeinflusst wurde. Doch der Spirit, der diese Songs antreibt, ist Widerstand. Doch auch wenn die Musik treibender wird, die Bassdrum mehr anzieht, der Techno stärker durchscheint, schreibt Jimeno keine Songs zum Faust-in-die-Luft-Recken. Auf „Acts Of Rebellion“ gibt es keine Protesthymnen. Stattdessen scheint sie die inneren Monologe einer Generation zu vertonen. Jimenos Rebellion heißt Empathie.

11. Sault – „Untitled (Rise)“
Wer sind Sault? Das weiß so genau niemand. Pressebilder gibt es nicht. Eine Mitgliederliste auch nicht. Klar ist, dass das mysteriöse britische Kollektiv im Schatten arbeitet – und wie eine Giftschlange überraschend und giftig zuschlägt. „Untitled (Rise)“ ist das zweite Surprise-Album, das Sault dieses Jahr veröffentlicht haben. Aus dem Nichts erschienen 15 Songs, denen man nicht ausweichen konnte. Diese Musik ist ein konfrontativer, tanzbarer, hochgradig politischer Sturm aus Afrobeat, Neo-Soul und HipHop – und, vor allem, ein unfassbares Geschenk.

10. Tom Misch & Yussef Dayes – „What Kinda Music“
Schlagzeuger Yussef Dayes und Produzent Tom Misch trafen das erste Mal bei einer Talentshow im den frühen Nullerjahren aufeinander. Es sollten über 15 Jahre ins Land ziehen, bis die beiden Briten ein gemeinsames Album veröffentlichen. Das Warten hat sich gelohnt. Auf „What Kinda Music“ klingt alles wie aus einem Guss. Mal wirkt ihre Zusammenarbeit wie ein Dialog zwischen zwei sich gegenseitig anspornenden Freunden. Misch beginnt das Album fragend, mit einem schief vor sich hin oszillierenden Synthesizer. Dayes antwortet mit einem triumphalen Breakbeat. Misch entgegnet mit einem gesampleten Streichquartett. Es entfaltet sich ein sich gegenseitig anfeuerndes Hin und Her, dem man stundenlang zuhören könnte. Gemeinsam können sie Genres erkunden, sich aus ihren Komfortzonen herausbewegen, wie im fast schon hart-rockenden „Lift Off“, oder im immer wieder in Abstraktion abdriftenden Avant-Funk von „Kyiv“. Oder einfach ihre Chemie genießen und Soul und Jazz spielen.

9. Kelly Lee Owens – „Inner Song“
Der entrückte, impressionistische Techno, der Kelly Lee Owens 2017 mit ihrem selbstbetitelten Debüt zum Star machte, ist auf „Inner Song“ noch pointierter und einladender als zuvor. „On“, der zweite Song der LP, kombiniert schiebende House-Klänge mit anschmiegsamem Dream-Pop. Owens scheint stets mit einem Bein auf einer Waldlichtung und mit dem anderem im Club zu stehen. Gegen Ende wird der Puls stärker, die Bass-Drum immer energischer, doch kurz vor dem Drop scheinen plötzlich abfallende Gesangsharmonien wie Sonnenstrahlen aus dem Himmel. Diese Strahlen erleuchten selbst straighte Techno-Banger wie „Melt!“ oder „Night“. Tracks, die in ihrer Essenz eigentlich zum hedonistischen Rumstampfen verleiten, wirken plötzlich wie Meditationsmusik.

8. Buscabulla – „Regresa“
Die beiden Puertoricaner*innen Raquel Berríos und Luis Alfredo Del Valle mussten erst nach New York ziehen, um sich zu finden. Doch als die zwei Musiker*innen aufeinander trafen, ging alles sehr schnell. Der Name ihres Duos: Buscabulla, das spanische Wort für „Unruhestifter“. Ihre Musik steht stark im Kontrast zum unheilversprechenden Namen: Die Sängerin und der Produzent brüteten im Big Apple einen Sound aus, der genauso von den Rhythmen ihrer Heimat wie von Indie-Pop-Acts des US-amerikanischen Festlands beeinflusst war, wie Beach House oder Toro Y Moi. Diese Stilmixe stiften keinesfalls Unruhe. Sie vereinen Gegensätze zu einem emotional komplexen Ganzen – Rückkehr und Aufbruch, Verlust und Neuanfang. Ihr Debüt „Regresa“ ist ein federleichtes Album über Melancholie. Ein wütendes Album voller Liebe. Ein trauriges Album voller Lebensfreude.

7. The Flaming Lips – „American Head“
Nach vielen mit haarsträubender Experimental-Musik und von sich selbst high werdender Psychedelia gefüllten Jahren kehrt die Psych-Pop-Institution The Flaming Lips mit „American Head“ wieder zu ihren Wurzeln zurück. Es ist – wie der Titel vermuten lässt – ihr US-amerikanischstes Album, gefüllt mit fluffigen The-Beach-Boys-Harmonien, The-Grateful-Dead-Jams und pathosgeladenen Loser-Storys à la Tom Petty oder Bruce Springsteen. Diese Musik ist seltsam, aber nie ausufernd. Barock-Pop, der wie unter Wasser aufgenommen wirkt. Ein vom Acid verwaschenes Duett mit Country-Star Kacey Musgraves. Gitarren, die wie Cumulus-Wolken am Kopf vorbeiziehen. Kurzum: Ein Pop-Album, wie es nur The Flaming Lips machen könnten.

6. Darkstar – „Civic Jams“
Wie feiert man in Krisenzeiten? Das Jahr 2020 gibt auf diese Frage eine ziemlich klare Antwort: Gar nicht. Glücklicherweise funktioniert die Musik von Darkstar auch außerhalb des Rave-Kellerlochs. Die Tracks des britischen Duos sind genauso von House und UK-Garage beeinflusst wie von Shoegaze und Dream-Pop. Ähnlich wie ihr Landsmann Burial produzieren James Young und Aiden Whalley Musik, die im Wohnzimmer genauso gut klingt wie im Club. Und auch wenn Darkstar losballern, tun sie das sehr sanft. Musikalisch klingen diese Tracks mehr wie der Afterglow. Theoretisch wären sie ein perfekter Soundtrack zum leicht verstrahlten Nach-Hause-Spazieren in den frühen Morgenstunden. Diese introvertierte Tanzmusik funktioniert auch ohne die euphorisierte Menge. Und passt damit wunderbar in eine Zeit, in der es nichts zu feiern gibt.

5. Die Sterne – „Die Sterne“
Wenn eine seit über einem Vierteljahrhundert aktive Band ihr neues Album nach sich selbst benennt, muss das irgendetwas bedeuten. Vorhang auf für „Die Sterne“. Das zwölfte Album der gleichnamigen Hamburger-Schule-Absolventen ist die erste LP, die Gitarrist und Sänger Frank Spilker ohne die Gründungsmitglieder Thomas Wenzel (Bass) und Christoph Leich (Schlagzeug) einspielte. Stattdessen versammelte er eine beeindruckende Riege an Gastmusiker*innen: Von Spar, The Düsseldorf Düsterboys, Kaiser Quartett, Carsten „Erobique“ Meyer, um nur einige zu nennen. Gemeinsam loten sie neue und altbekannte Pfade zwischen Disco-Exkursionen, White-Boy-Funk und Barock-Pop aus.

4. King Krule – „Man Alive!“
Alles beim Alten auf dem dritten Album der britischen Reibeisenstimme King Krule? Nun ja, da ist die Wut in „Stoned Again“, die schlummernde Euphorie von „The Dream“ und der Downer „(Don’t Let The Dragon) Draag on“. Zusätzlich verstärken Tracknamen wie „Perfecto Miserable“ den Anschein, dass sich in Archy Marshalls Gesamtwetterlage – ergiebiger Nieselregen gepaart mit Gegenwind – wenig getan hat. Sobald man aber dem sanft-schroffen Track ein Ohr leiht, fällt trotz knurrenden und zitternden Gitarren auf: Das ist ja ein Lovesong. Zwar verzweifelt, aber jemand scheint Marshall in die Sonne gestellt zu haben. Ansonsten gibt es Gesellschaftskritik und überraschend zarte Lieder, möglicherweise motiviert von der Geburt seines ersten Kindes. Also alles beim Alten? Fast. Zwei, drei Farbtupfer sind dazu gekommen.

3. Yves Tumor – „Heaven To A Tortured Mind“
„Heaven To A Tortured Mind“, das vierte Album des Genre- und Geschlechtergrenzen einreißenden Projekts Yves Tumor aus Tennessee, beginnt mit dem Pathos eines Boxers, der zu seinem großen Comeback-Match in den Ring steigt. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Das Album markiert das Ende einer Transformation: Tumor, bürgerlich Sean Bowie, startete seine Karriere als Noise-Avantgardist. Heute ist er ein Rockstar. Die Bläser-Fanfaren, Prince-Gitarren und Bombast-Funk-Grooves von „Heaven To A Tortured Mind“ geben einem das Gefühl, einen Marathon laufen zu können. Obwohl man die Wohnung seit Monaten nicht verlassen hat.

2. Caribou – „Suddenly“
Man kennt sie: Die Momente, in denen das Leben von einem Moment auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt wird. Dan Snaith kann ein Lied davon singen. Der kanadische Produzent und Songwriter hat das neue Album seines langjährigen Projekts Caribou nicht ohne Grund „Suddenly“ genannt. War seine 2014 erschienene LP „Our Love“ noch ein Gesamtwerk über die Freuden und Schwierigkeiten der Zweisamkeit, ist sein neuestes Album eine Auseinandersetzung mit plötzlichen Veränderungen. Ein Album, gefüllt mit unerwarteten Anfängen und abrupten Rissen. Mit sonnigen Stax-Soul-Samples und den einsamsten Klavierklängen der Welt. Voller Liebe und Tod. Songs, die zeigen, wie das Leben nach dem Schicksalsschlag weitergehen kann.

1. Sault – „Untitled (Black Is)“
Das Cover von „Untitled (Black Is)“, dem ersten von zwei 2020er-Überraschungsalben des Kollektivs Sault, ziert eine schwarze Faust. Da man über die Mitglieder der britischen Band so gut wie keine Informationen findet, muss man sich auf die Sachen konzentrieren, die offensichtlich sind: Die Faust ist eine kulturhistorische Ikone. Sie ist der bildliche Bezug auf Black Power, die Black Panther Party und die Kämpfe der afrikanischen Diaspora und für „Schwarz“ gelesene Menschen ein Symbol der Kraft. Die gereckte Faust als Zeichen der Hoffnung auf Veränderung und ein Aufruf, diese selbst herbeizuführen.
Es gibt kein Symbol, das besser zu der Musik von Sault passen könnte. „Untitled (Black Is)“ strahlt die Gewissheit aus, dass eine bessere Welt nicht nur nötig, sondern auch möglich ist: „We can make a change and we can make it different“, heißt es im Titeltrack. Vor dem Hintergrund der Proteste gegen Polizeigewalt und systemischen Rassismus, als Teil der Black-Lives-Matter-Bewegung gewinnt die Sault-Inszenierung an Gewicht. Ein Image, eine Marke hat jeder Act, ob er es will oder nicht. Sault nutzen sie, um das afrikanische, afrobritische und afroamerikanische kulturelle Erbe und die Geschichte rassistischer Unterdrückung herauszustellen. Ein radikales, wichtiges Soul-Statement, das trotz oder wegen seiner spärlichen Bebilderung weit über die Musik hinausgeht.
 </“https://www.byte.fm/freunde/mitglied-werden/“a>
</“https://www.byte.fm/freunde/mitglied-werden/“a> 


