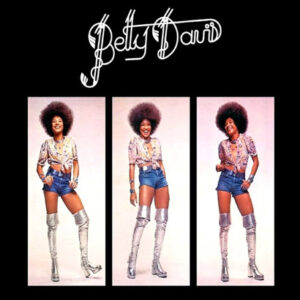Janelle Monáe – „Dirty Computer“ (Bad Boy Entertainment)
7,0
Angesprochen auf die Gerüchte um ihre Bisexualität hatte Janelle Monáe für das Musikmagazin Rolling Stone diese wundervolle Antwort parat: „I consider myself a free-ass motherfucker“. In diesem Interview geht es um viele spannende Aspekte im Leben der US-amerikanischen Künstlerin, wie zum Beispiel dem Tod ihres Mentors Prince und dessen Auswirkungen auf ihr neues Album „Dirty Computer“ – doch trotzdem ist es dieser Satz, der hängen bleibt.
Von der ersten Sekunde ihrer ersten EP „Metropolis: Suite 1 (The Chase)“ gestaltete sich die US-amerikanische Künstlerin als afrofuturistischer, erdenfremder Android, dessen metallene Hülle wie ein Schutzpanzer um sie aufgebaut war. Nun erscheint mit „Dirty Computer“ das dritte Studioalbum von Janelle Monáe – auf dem zum ersten Mal der Mensch unter der metallenen Oberfläche greifbar zu sein scheint. „Even though you tell me you love me / I’m afraid that you just love my disguise“, singt sie in der Ballade „Don‘t Judge Me“ und klingt dabei so verletzlich wie noch nie zuvor.
Tränen als Empowerment
Diese neue Transparenz zeigt aber nicht nur Verwundbarkeit, sondern auch eine neue Stärke. So verwandelt sie in dem bemerkenswerten Spoken-Word-Breakdown des R&B-Pop-Glanzstückes „I Like That“ Tränen in Empowerment: „But even back then with the tears in my eyes / I always knew I was the shit“. Soviel ist klar: Monáe lässt sich nicht in eine Opferrolle drängen. Stattdessen regnet es Kampfansagen gegen all die großen und kleinen Unterdrücker dieser Welt: „Mansplaining, I fold ‚em like origami / What’s a wave, baby? This a tsunami“, heißt es in der Single „Django Jane“. Und wenn die Männer sich gegen ihre Pussy-Riot stellen, dann gibt es halt eine Pussy-Diet.
Während Monáe in ihrer neu gewonnenen Freiheit aus jeder Zeile von „Dirty Computer“ pures, unbändiges Charisma versprüht, ist die Musik unter diesen Zeilen ironischerweise um einiges steriler geworden. Der quicklebendige Funk des Vorgänger „Electric Lady“ ist einem deutlich gezähmten Sound gewichen. Computer-Beats und Radio-Pop-Harmonien bremsen das Momentum hinter Songs wie „Crazy, Classic, Life“ oder der Grimes-Kooperation „Pynk“ leider ziemlich aus. Die lahme Hedonismus-Utopie „Screwed“ (vorgetragen im Duett mit Zoë Kravitz) hätte man sich vielleicht ganz sparen können. Und den Harmonien-König Brian Wilson im Titeltrack in einem generischen See aus Autotune und Vocoder zu ertränken vielleicht auch, auch wenn sie damit abermals ihre Unabhängigkeit von Pop-Konventionen beweist.
„Dirty Computer“ ist also leider nicht ganz das umwerfende Album geworden, das es hätte sein können. Doch vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Für die Künstlerin Janelle Monáe scheint es auf jeden Fall ein Befreiungsschlag zu sein, ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstrealisierung. Sie bleibt in jedem Fall ein „free-ass motherfucker“.
Veröffentlichung: 27. April 2018
Label: Bad Boy Entertainment